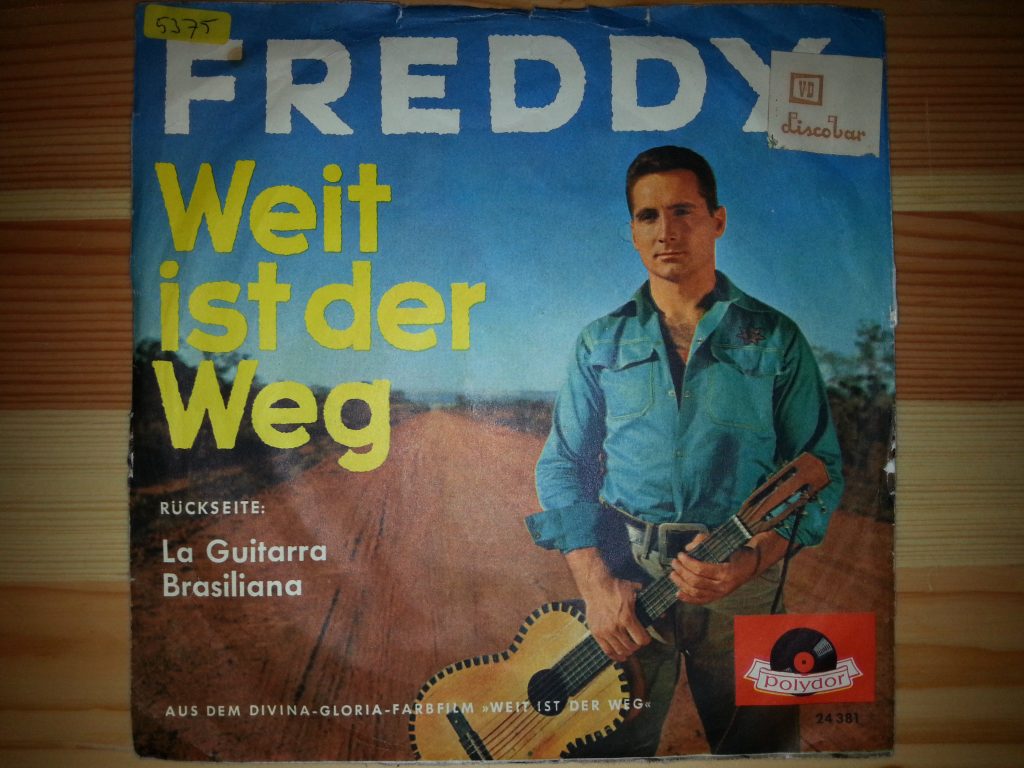Wenn das Wetter so ist wie heute, wenn also die Sonne strahlt und der Himmel blau ist und die Temperatur in einem Bereich jenseits der 25° C liegt, wenn man schwitzt und einem der Schweiß in Strömen den Rücken hinunter läuft, dann fällt es einem nicht besonders schwer den Schluß zu ziehen, dass es eigentlich Zeit für einen ausgiebigen, längeren Urlaub sein müsste. Das war im Wirtschaftswunder nicht viel anders. Außer, dass man sehr wahrscheinlich nicht so viel Urlaub zur Verfügung hatte, wie das heutzutage für gewöhnlich der Fall ist. Jedenfalls was Menschen betrifft, die in der glücklichen Situation sind, einen Arbeitsplatz zu besitzen, dessen Arbeitsbedingungen tarifvertraglich halbwegs akzeptabel geregelt sind. Damals war das nicht so. Da hatte man vielleicht drei Wochen Urlaubsanspruch, wenn überhaupt. Und die wollte man genießen. Im Süden. In der Sonne Italiens, Südfrankreichs, oder auch Spaniens. Wir müssen uns allerdings vor Augen führen, dass es in den 50er bis 60er Jahren und auch noch weit in die 70er Jahre hinein, eher unüblich war, einen organisierten Urlaub im Stile von “All-inklusive” zu buchen und dann irgendwo hin zu jetten mit nicht viel mehr, als einer Reisetasche mit mehreren Ersatz T-Shirts und zwei Unterhosen, im Gepäck. Die Tourismusbranche war praktische noch nicht erfunden. Hotelburgen, die über dutzende von Kilometern hinweg die Strände verunzierten, gab es auch noch nicht. Es war schon eine Menge Eigeninitiative gefragt, wenn man verreisen wollte. Ein großer Teil der deutschen Wirtschaftswunderbürger verbrachte seine Ferien sowieso in heimatlichen Gefilden, also in Deutschland. Man reiste in die Alpen, um zu wandern, oder in den Schwarzwald und den Harz. Andere, die mehr auf Meer standen, entschieden sich für die Nord- oder die Ostsee. Dort konnte man sich herrlich entspannen und auch mal die Füße ins dezent nahe dem Gefrierpunkt herum rauschende Wasser tauchen.

Messerschmitt Kabinenroller, damit fuhren Leute in den 50er und 60er Jahren über die Alpen bis nach Italien, Fotos: A. Ohlmeyer

VW Käfer mit beladenem Dachgepäckträger, fertig zum Start in den Urlaub in den 50er und 60er Jahren, Fotos: A. Ohlmeyer
Ab der Mitte der sechziger Jahre wurde es dann üblich, nach Süden zu reisen. Wer kein eigenes Fahrzeug besaß, oder sich die Ochsentour, beispielsweise über den Brenner, nicht zutraute, konnte mit dem Zug fahren. Oder er vertraute sich und die Familie und die kostbarsten Tage des Jahres, einem Busfahrer an, der sein Gefährt im Auftrag eines Reisebüros in den Süden lenkte. Problematisch war dabei immer das Gepäck. Da der Stauraum in Bus und Bahn eher begrenzt, die Zahl der Mitreisenden dafür aber umso größer war, musste man sich eben ein wenig einschränken. Aber nicht nur da. Auch wer auf eigener Achse den Weg in den Süden suchte, unter zuhilfenahme einer möglichst aktuellen Straßenkarte, der musste sich immer mit den Platzverhältnissen in seinem motorsierten Gefährt beschäftigen. Denn je nachdem, was für ein Fahrzeug man sich leisten konnte, war auch hier ein gewissen Maß an Zurückhaltung geboten. Menschen, die zu zweit unterwegs waren, konnten sich vielleicht einen Kabinenroller leisten, oder auch nur einen Motorroller. Da war nicht viel Platz, an dem man sein Gepäck verstauen konnte. Der Motorroller verfügte über einen Gepäckträger und ein klein wenig Platz in einem Rucksack und, wenn es sich um einen Heinkel Tourist handelte, einen weiteren kleinen Gepäckträger vor dem Lenker über dem Scheinwerfer. Den Kabinenroller konnte man mit etlichen kleineren Gepäckstücken ausstopfen und auf der Heckklappe, unter der sich der winzige Zweitaktmotor verbarg, montierten viele Reisende einen Gepäckträger, auf dem man ein zusätzlichen Köfferchen befestigen konnte. Da war gute Planung angesagt, denn wer konnte es sich damals schon leisten, im Urlaub jeden Tag in irgendeinem Restaurant zu abend zu essen, mittags ebenfalls irgendwo eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen, ganz zu schweigen vom Frühstück. Das alles kostet Geld. Geld, dass die meisten einfach nicht besaßen, bei den damals üblichen Monatslöhnen. Also musste ein kleines Zweimannzelt (eine sogenannte Dackelgarage!) mit und ein Gas- oder Petroleumkocher, nebst Kochgeschirr, um sich selbst versorgen zu können. Ein paar Kleidungsstücke, auch etwas wärmere Teile, falls das Wetter nicht den Erwartungen entsprechen sollte, waren auch immer dabei. So bepackt, ging es über hunderte, ja tausende von Kilometer in den Süden, der Sonne entgegen. Die Vorfreude war enorm, die Erwartungen hoch und der Traum vom Urlaub rückte mit jeder Stunde, die die Fahrt dauerte, näher. Man muss sich das wirklich einmal vorstellen. Zwei Menschen, eingepfercht in eine rollende Käseglocke namens Kabinenroller, oder auf einem Motorroller, beide kaum mehr als 80 km/h schnell – in unbeladenem Zustand – und dann, erst über die bundesdeutschen Straßen bis an die Alpen, dann über die Alpen hinüber (meist über den Brenner), dann weiter durch Nord- und Mittelitalien, bis ans Ziel der Wünsche, die Adria, die Insel Capri, den Golf von Neapel oder was weiß ich, wohin noch überall. Das war zweifellos eine echte Tortur. Wer das überstand, bei den damaligen Straßenverhältnissen (ein gut Teil der Alpenpässe war noch nicht einmal mit einer Asphaltschicht versehen, der war wirklich am Ziel seiner Träume angelangt.

Wohnwagen Eriba Pan 1967, so luxuriös könnte man in den 60er Jahren schon reisen, Fotos: A. Ohlmeyer

Wohnwagen Eriba Pan 1967, bequeme Sitzecke mit versenkbarem Tisch und den zeittypischen “Paradekissen”, Fotos: A. Ohlmeyer
Die etwas besser gestellten Menschen besaßen damals schon ein Auto, ein echtes Auto, mit vier Rädern und einem festen Dach über dem Kopf. Einen VW Käfer zum Beispiel. Zwar noch mit einem Brezelfenster im Heck, oder einem ovalen Heckfenster, aber immerhin. Vielleicht fuhr man auch einen Lloyd (genau der, der immer am Berg steht und heult, wie man damals schonungslos zu lästern pflegte), einen Ford 12m, einen Opel Olympia? An die größeren Fahrzeuge konnte man sogar einen Anhänger hängen, vielleicht sogar einen Wohnwagen. Die allermeisten aber machten aus ihrem Auto einen Packesel. Der Kofferraum wurde bis zum Anschlag vollgestopft mit Taschen und Koffern. Dann wurde der Dachgepäckträger mit Koffern beladen, diese mit Schnur befestigt und fertig war der Reisewagen für die große Tour. Drinnen saßen die Eltern auf den Vordersitzen, hinten die Kinderchen, oft Stücker zwei oder drei. Niemand war angeschnallt. Alles sprang und tobte durcheinander und hoffte, dass nichts passierte unterwegs.

Wohnwagen Eriba Pan 1967, Küchenblock mit Gasherd, Kühlschrank vorne rechts und Heizung unter dem Schrank, Fotos: A. Ohlmeyer
Wer einen Wohnwagen besaß, meist waren das faltbare Wohnwagen in der Art, dass man das Dach aufstellen konnte, um Stehhöhe zu erlangen. Teiweise konnte man die Wände herausziehen um Platz zu gewinnen, wenn man auf einem Campingplatz einen Stellplatz ergattern konnte. Die Innenausstattung war eher bescheiden, wenn man es mit heutigen Campingmobilen, oder Wohnwagen vergleicht. An eine Toilette, oder Dusche im Wohnwagen war nicht zu denken. Sie waren einfach zu klein und man musste Gewicht sparen. Die als Zugmaschinen vorgesehenen Automobile waren noch ziemlich schwachbrüstig. Also musste das Gewicht der Wohnwagen entsprechend gering sein. Am beliebtesten waren die Faltwohnwagen, die man sogar hinter einen Fiat 500 hängen konnte. Sie waren meist etwas breiter als ein gewöhnlicher Anhänger und nicht viel höher als einen halben Meter. Stand man auf einem Campingplatz, klappte man das Teil auseinander. Das Dach nach oben, das Heck wurde heraus gezogen, Die Wände aufgeklappt, teils aus Holz, teils aus Zeltstoff. Es gab winzige Waschbecken, ein- oder zweiflammige Gaskocher zum Zubereiten der Mahlzeiten. Gelegentlich war sogar ein Kühlschrank, oder eine Kühlbox eingebaut. Siztecke, versenkbarer Tisch, aus denen man eine Liegewiese bauen konnte, wenn man schlafen gehen wollte, rundeten die Ausstattung ab. Ein Schränkchen, ein Kanister mit Wasser, ein Picknickkorb. Mehr brauchte es nicht, um glücklich zu sein.

Wohnwagen Dethleffs Tourist 1955, aufstellbares Dach, Fotos: A. Ohlmeyer

Wohnwagen Dethleffs Tourist 1955, Sitzecke mit Heizung, Fotos: A. Ohlmeyer

Wohnwagen Dethleffs Tourist 1955, Küchenzeile, mit Elektrokochfeld mit zwei Platten, Waschbecken und entzückendem Wasserhahn. man beachte den Toaster auf der Küchenablage, Fotos: A. Ohlmeyer
Schaut man sich die Ausstattungen heutiger Wohnwagen an, muss man sich schon die Augen reiben. Natürlich braucht der Mensch von heute wesentlich mehr, als die Leute damals. Man hatte ja auch wesentlich weniger Ansprüche. Das ist heute anders. Alles, absolut alles ist heute ein Statussymbol, mit dem man sich und seiner Umwelt zeigen muss,m zu was man es gebracht hat, selbst wenn man es garnicht bezahlt hat. “Gelobt” seien Leasing- und Ratenzahlungsverträge. Ein Reisemobil ohne WC und Dusche? Undenkbar! Kein Fernseher an Bord? Ja scheiß doch die Wand an! Wie war man in den 50er und 60er Jahren doch so schön bescheiden. Jedenfalls meistens. Oder wenigstens manchmal. Denn auch damals zeigte man gern, was man hat. Mit solchen Voraussetzungen war ein abenteuerlicher Urlaub garantiert, von dem man das ganze restliche Jahr zehren konnte, bis es einen wieder in den Süden zog.

Faltwohnwagen, Sitzecke, Fotos: A. Ohlmeyer

Faltwohnwagen, Sitzecke mit seitlicher Ablage, man beachte das wunderschöne Philipps Phileta Röhrenradio aus den 50er Jahren, Fotos: A. Ohlmeyer

Faltwohnwagen, Küchenblock mit Elektrokochfeld mit zwei Platten und Waschbecken, Fotos: A. Ohlmeyer
Wieder andere Menschenbesaßen zwar ein “echtes” Automobil, aber keinen Wohnwagen und sie waren auch nicht bereit, ihr Dach mit einem Dachgepäckträger zu verunstalten und so den Luftwiderstand enorm zu erhöhen und damit den Spritverbrauch. Also entschieden sie sich für einen Hänger, in dem sie ihr Urlaubsgepäck vertauten und so im Innenraum ihres Autos nur unwesentliche Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Oder die Familie war damals so zahlreich, dass der kleine Anhänger notwendig war, um alles was nötig war auch mitnehmen zu können. Wenn ich mich selbst erinnere, wie ich mit meinen Eltern in den frühen sechziger Jahren in den Urlaub fuhr, im Opel Kadett A, dann hatte ich danals und habe es auch bis heute, das unbestimmte Gefühl, wir hätten damals stets den kompletten Hausstand mit in den Urlaub genommen. Bettzeug, Kleidung, Bügeleisen, ein paar Ersatzteile für das Auto, ja sogar Kühlflüssigkeit für den Notfall. Ein 20-Liter-Blechkanister mit gutem deutschen Superbenzin, damit man unterwegs möglichst nicht tanken musste, bevor man das Ziel im österreichsichen Kärnten erreicht hatte, Spielzeug, Badesachen, Lebensmittel (ja wirklich!), eine Spielesammlung für schlechtes Wetter. Das Kofferradio vom regal im Wohnzimmer, das meine Mutter während unserer Ferienfahrten immer zwischen den Knien halten musste, damit Papa nachrichtentechnisch immer auf dem Laufenden war und sich mit Musik bedudeln lassen konnte.

Westfalia Gepäckanhänger aus den 50er Jahren, ein extra Kofferraum auf Rädern, Fotos: A. Ohlmeyer